Zwischenbericht I
Zwischenbericht I aus dem Modellprojekt FaBi
"Ein Kindergarten für alle Kinder" - Zwischenbericht FaBi
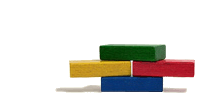 Zwischenbericht zum Modellprojekt Inklusion im Kindergarten des Beratungs- und Assistenzdienst zur Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Assistenzbedarf in Kindergärten in Stadt und Landkreis Reutlingen
Zwischenbericht zum Modellprojekt Inklusion im Kindergarten des Beratungs- und Assistenzdienst zur Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Assistenzbedarf in Kindergärten in Stadt und Landkreis Reutlingen(Autor:
Einführung der Projektleitung
Forschung an der Evang. Fachhochschule Reutlingen - Ludwigsburg (EFHS) war und ist Handlungsforschung im Sinne von Praxisentwicklung. Im Gegensatz zu früher, als die EFHS als Träger auch die Verantwortung für das Gesamtprojekt übernahm, wurden in letzter Zeit verstärkt die Kooperation mit bestehenden Strukturen der Selbsthilfe und der Praxis gesucht. Dabei geht es vor allem um die regionale Einbindung und die Kontinuität der Arbeit über den projektierten Zeitraum hinaus.
Der Kooperationspartner "Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V." ist eine Selbst-hilfeorganisation mit der die EFHS schon auf verschiedenen Ebenen zusammengearbeitet hat.
Die Übernahme der Trägerschaft stellte allerdings für den kleinen Verein eine große Herausforderung dar, zudem sich die verwaltungsmäßige Unterstützung des Projekts durch die EFHS wegen der Verlagerung nach Ludwigsburg sehr reduzierte. Wir bedanken uns für die Hilfe der Gustav Werner Stiftung bei wichtigen Verwaltungsabläufen.
Für die Projektleitung und die wissenschaftliche Begleitung der Fachhochschule bedeutete dies, neben der Weiterentwicklung und Umsetzung der konzeptionellen Vorgaben, die kontinuierliche Begleitung und Unterstützung des Projekts in der Praxis. Neben inhaltlichen und organisatorischen Fragen ging es dabei in der ersten Phase für alle Beteiligten auch um die Kooperationen und die Öffentlichkeitsarbeit in Stadt und Landkreis und auf Landesebene.
Auf allen Ebenen wurden vielfältige Erfahrungen gemacht, die in diesem Bericht ansatzweise thematisiert sind und im laufenden Prozeß weiterentwickelt und systematisiert werden sollen. Neben der Organisation und Arbeitsweise des Fachdienstes (FABI), geht es vor allem um die berufliche Rolle und den Status der "InklusionsassistentInnen".
Insgesamt wird von allen Beteiligten die Entwicklung des Projekts erfreulich positiv eingeschätzt. FABI begleitet inzwischen 15 InklusionsassistenInnen, die bei der Arbeitsgemeinschaft Integration (teilzeit-) beschäftigt sind.
Wir bedanken uns
- bei dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, dem Vorstand und MitarbeiterInnen der Arbeitsgemeinschaft Integration, den KooperationspartnerInnen in Stadt und Landkreis und dem Vertreter des Landesjugendamtes für die gute Zusammenarbeit,
- bei den Geldgebern (Aktion Mensch, Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern) für die finanzielle Unterstützung und hoffen, daß wir das Projekt auch finanziell erfolgreich weiterführen und zum Abschluß bringen können.
Februar 2002
Prof. Dr. Werner Schumann
"Ein Kindergarten für alle Kinder" - Zwischenbericht FaBi
1. Aktueller Diskurs
"Die Kraft unserer Träume liegt darin, unsere Sicht
der Dinge und damit auch die Welt zu verändern.
Wenn genug Menschen einen bestimmten Traum haben,
dann wird er am Ende Realität werden" (Paulo Coelho)[1]
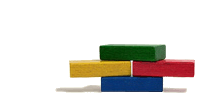 Mit diesem Gedanken und Hoffnungen von Paulo Coelho betrachten wir
rückblickend die ersten Schritte des Projekts und sehen Chancen auf eine
veränderte Realität an Orten, an denen die Beteiligten die Hoffnung
haben und die Bereitschaft zeigen, Kinder mit Assistenzbedarf an dem Leben in
Regeleinrichtungen teilhaben zu lassen.
Mit diesem Gedanken und Hoffnungen von Paulo Coelho betrachten wir
rückblickend die ersten Schritte des Projekts und sehen Chancen auf eine
veränderte Realität an Orten, an denen die Beteiligten die Hoffnung
haben und die Bereitschaft zeigen, Kinder mit Assistenzbedarf an dem Leben in
Regeleinrichtungen teilhaben zu lassen.
In unseren konzeptionellen Überlegungen ist der Inklusionsgedanke als ein
zentraler Baustein unseres Arbeitsverständnisses verankert und soll im
Projekt auch wirksam werden. Inklusion ist für uns kein neues Zauberwort.
Inklusion ist ein Verständnis, eine Anschauung von Zusammensein und
Zusammenleben in der Gesellschaft, bei dem die Menschen mit
Unterstützungsbedarf bzw. ihre Familien selbstverständlich an
den täglichen Begegnungsformen teilhaben können und mit ihren
Bedürfnissen und Wünschen ernst genommen werden.
Inklusion bedeutet, dass wir grundsätzlich Menschen mit Assistenzbedarf
miteinschließen (includere = miteinbeziehen, miteinschliessen,
Miteinbezogen-Sein). Das heißt konkret: Regeleinrichtungen in unserer
Gesellschaft wie z. B. Kindergärten müssen dahingehend geöffnet
und ausgestattet werden, dass sie für Kinder mit Unterstützungsbedarf
selbstverständlich zugänglich sind. Inklusion in diesem Sinne
heißt auch, dass die Verschiedenheit der Menschen mit Achtung
wahrgenommen wird und deshalb alle Kinder mit Unterstützungsbedarf
gleichberechtigt am gemeinsamen Alltag wie die anderen teilhaben können.
Mit anderen Worten: nicht nur Kinder mit wenig Assistenzbedarf, sondern jedes
Kind soll in den Regelkindergarten gehen können bzw. ist als Mitglied der
Gemeinde im Regelkindergarten willkommen.
Sehr eng verbunden mit den Gedanken der Inklusion ist das Konzept von
Community Care bzw. Community living. Die Grundgedanken dieser Ansätze
kommen aus den USA und zielen darauf ab, dass Menschen mit Assistenzbedarf vor
Ort, in der Gemeinde, in ihrem sozialen Netzwerk unterstützt werden
sollen.
Bezogen auf den "Fachdienst Assistenz, Beratungsdienst und Inklusion" (FABI)
heißt dies, dass wir uns auch bemühen, die Integration im
Kindergarten als Ausgangspunkt zu nehmen, um Möglichkeiten zu entwickeln,
die Situation innerhalb und außerhalb des Kindergartens mit den
vorhandenen Ressourcen inklusiv zu gestalten. Dieses Ziel umzusetzen bedarf
Visionen und auch das Bemühen, im Laufe des Projekts die notwendigen
Rahmenbedingungen zu erarbeiten.
I.
Betrachten wir die gegenwärtige Diskussionen über die Kindergartensituation, so gibt es verschiedene inhaltliche Anknüpfungspunkte für das Ziel und Vorhaben einer integrativen und inklusiven Ausrichtung des Regelkindergartens. Im folgenden werden deshalb einzelne Aspekte angesprochen, die im Verlauf des Projekts mitverfolgt und verknüpft werden sollen.
- Die Kindergartenzeit ist wieder im Gespräch. Während in den
letzten Jahren die Vorschulzeit bzw. das Vorschulalter kein Gegenstand bei den
dominanten öffentlichen Veränderungsdiskursen war, ist
spätestens mit der Pisa-Studie im letzten Winkel Deutschlands die Frage
aufgetaucht, warum unser Bildungssystem so schlecht ist bzw. die Ergebnisse so
unbefriedigend sind, obwohl wir nicht wenig Geld dafür ausgeben. Diese
Diskussion über Bildung und Schule betrifft auch den Kindergarten, der
zwar schon länger in Fachkreisen über die Diskussion des
Bildungsauftrags im Gespräch war, darüber hinaus aber wenig Resonanz
fand. Schon vor der Ergebnispräsentation der Pisa-Studie kam eine
grundsätzliche Diskussion über Kindheit und Lernen in Gang. Ein
Beispiel dafür war die große Nachfrage - auch außerhalb von
Fachkreisen - nach dem Buch von Donata Elschenbroich über das "Weltwissen
der Siebenjährigen". In diesem Buch werden viele Themen angesprochen, die
sowohl in der Pisa-Studie als auch in den Veröffentlichungen des "Forum
Bildung" zur Sprache kommen.
- Gemeinsam aller Studien ist die Lehr- und Zauberformel: "Lernen zu lernen",
die für alle Altersgruppen (also auch für ältere
ArbeitnehmerInnen) gilt. Hier stellt sich für unseren Arbeitsbereich die
Frage: welche "Basic skills" und Grundqualifikationen sollen im
Kindergarten(alter) vermittelt werden?
Nehmen wir die ersten Reaktionen auf die Pisa Studie, so scheinen in Baden-Württemberg u.a. die Interpretationen der Ergebnisse zu Schlußfolgerungen zu führen, die sehr stark auf erhöhten Leistungsdruck und Eliteförderung abzielen[2]. Dies ist insofern vor allem vor dem Hintergrund der Pisa-Ergebnisse erstaunlich, weil hier die große Kluft zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen SchülerInnen in Deutschland bemängelt wurde und eine integrative Erziehung gefordert wird. SchülerInnen mit weniger Bildungskapital müssen stärker gefördert werden und hier soll schon bereits im Kindergarten begonnen werden. - Die derzeitigen Debatten über die neuen Anforderungen im Kindergarten
bieten für uns die Chance, die möglichen Folgen der Integration von
Kindern mit Assistenzbedarf im Kindergarten in ihrer Qualität und
Lernchance darzustellen. Gehören Kinder mit Assistenzbedarf in den
Kindergarten, um Schlüsselqualifikationen zu vermitteln, die gerade durch
diese Herausforderung, sich "Fremden" anzunähern, erprobt werden kann.
- Bildung als Aufgabe für den Kindergarten bzw. die
Kindertagesstätten soll nach den Empfehlungen des "Forum Bildung"
(Bund-Länder-Gremium) stärker gefördert werden. In erster Linie
soll das "Lernen zu lernen" kindgerecht vermittelt werden und hierzu
müssen neue Konzepte der Weiterbildung u.a. auch für ErzieherInnen
entwickelt werden sowie die Vernetzung im Gemeinwesen (vgl. Empfehlungen 1, 3
und 10). Der Qualifizierungsbedarf von Professionellen im Bereich der Erziehung
steht außer Frage.
- Für den Kindergarten und seine zukünftigen Aufgaben
erkenntnisreich sind u.a. folgende zwei Aspekte aus der Pisa-Studie:
Erstens: Einigkeit besteht darin, dass sich die Lernkultur ändern muß. Hier stellt sich die Frage, ob ein Kindergarten für alle eine Veränderung mit sich bringt, die Chancen neuer Lernmöglichkeiten für alle bereithält. Im internationalen Vergleich zeigen die Ergebnisse der PISA-Studie, dass Länder, in denen selektive Systeme eingesetzt werden, schlechter bzw. auf jeden Fall nicht besser abschneiden (vgl. Kerstan 2001 :46).
Zweitens: Wie kommt es, dass auf dem Innovationsindex der EU das Land Nummer eins Schweden ist, dessen Schulen bis zur achten Klasse keine Noten geben? Ist es möglich, dass im internationalen Vergleich Schüler aus einem System gut abschneiden, in dem das Gesetz verbietet, in den ersten neun Klassen nach Leistungen zu sortieren? Die neunjährige Allgemeinschule in Schweden ist eine Gesamtschule, die alle SchülerInnen besuchen. (vgl. Kahl 2001a :48). Diese Erfahrungen zeigen doch, dass Leistungsforderungen und Vorwürfe an fehlende Leistungsbereitschaft keine Wirkung erzielen werden. Vielmehr wird es darauf ankommen, auch bei uns nachzuweisen, dass ein gemeinsamer Alltag die Chancen für alle verbessern kann. - Integration als vorschulische Bildung kann auf diesem Hintergrund ein
aktuelles Thema werden. Zunächst erweckt es den Eindruck, dass die
Ergebnisse nur bedingt mit der Situation von Kindern mit Assistenzbedarf in
Zusammenhang gebracht werden können, weil das Thema Integration von
Kindern mit Assistenzbedarf in der allgemeinen Diskussion randständig
bleibt, wobei die Notwendigkeit proklamiert wird, wie folgendes Zitat zeigt:
"Behinderte[3] sind stärker in
Regeleinrichtungen zu integrieren. Dafür müssen die Bedingungen
für eine individuelle Förderung von Behinderten in Regeleinrichtungen
verbessert werden" (Forum Bildung 2001 :13).
Die grundlegende Diskussion über den Sinn des Lernens ist aber an die Integrations- und Inklusionsdebatte anschlussfähig, weil hier bei einer ernsthaften Auseinandersetzung über unterschiedliche Kompetenzen, gegenseitige Anerkennung und Verantwortung neue Wege aufgezeigt werden können. Neben der Frage, welche Bilder wir Erwachsene über Kinder haben, fragen wir uns, inwieweit hierzu auch selbstverständlich die Position des "Fremden", des "Nicht-Vertrauten" einen Platz einnehmen sollte. Das Credo der Diskussion: Selbständigkeit und Neugier müssen stärker geweckt werden sowie die Möglichkeit, eigene Lösungswege zu finden. Integration bietet dafür u.a. ein zukunftsfähiges Lernmodell - auch deshalb, weil es das "Lernen ohne Grenzen" (EU-Slogan) im wahrsten Sinne des Wortes real werden lässt. Diese Gedanken sind nicht neu, sondern schon seit langem aus der Integrationsbewegung bekannt. Exemplarisch hat dies Feuser (1984) mit dem Spielen und Lernen an einem gemeinsamen Gegenstand, bei dem jeder nach seinen spezifischen Möglichkeiten teilhaben kann, aufgezeigt. - Wenn die wissenschaftlichen Forschungen des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung Berlin an Schulen auf den Kindergarten übertragen werden
können, dann wird deutlich, dass es nach Baumert´s Aussagen vor allem
auf den "Eigensinn" einer Einrichtung ankommt, auf den Geist, der dort weht
(vgl. Kahl 2001b: 49).
- Diese Diskussion über Haltungen und Einstellungen der Beteiligten zur
Inklusion ist durch die Richtlinien und ihre ersten Umsetzungsversuche virulent
geworden. Sie zeigen, dass Inklusion auch eine Frage des politischen Willens
ist. Es wird daher für das Modellprojekt wichtig werden, wie die
Erfahrungen eines gemeinsamen Alltags von Kindern mit mehr und weniger
Assistenzbedarf in den Prozeß der Weiterentwicklung der Richtlinien und
der politischen Willensbildung miteingebracht werden können.
II.
Die Entwicklungen im Sozialen Bereich analog zu Wirtschaftsbetrieben ist in manchen Bereichen überfällig, aber in anderen nicht ohne Gefahren. Die Frage nach den "rentablen" Geschäften, die durch die Privatisierung im Sozialen Bereich auch einen Schub erhalten haben, lässt Strategien erkennen, die auch bedenkliche Formen annehmen wie z. B. im Pflegebereich, nach dem Motto: Hauptsache "satt und sauber". Die Suche nach GeschäftspartnerInnen, die für weniger Geld Leistungen erbringen, die Einrichtungen nicht mehr selbst durchführen und deshalb ausgelagert werden, werden im Sozialen Bereich nicht ohne gravierende Folgen bleiben.[4] Die Frage nach der Qualität der Leistung kann leicht in den Hintergrund geraten, wenn die billigsten AnbieterInnen locken.
Diese Diskussion hat vor allem für FABI Bedeutung, weil die Arbeitsgemeinschaft Integration als Träger von außen kommt, selbst outsource-Anbieter ist und somit den Prozess der Verlagerung auch mitträgt. Eine wichtige Voraussetzung liegt aber darin, dass trotz der ausgelagerten Leistungen die Arbeitsgemeinschaft Integration auf eine gemeinsame Verantwortung mit dem Kindergarten(träger) nicht verzichten kann.
Die Chancen dieser Konstruktion liegen in den über viele Jahren in der
Integrationsbewegung gewonnenen Erfahrungen und Kompetenzen der Eltern, die als
Basis für den Fachdienst, den Blick für die zentralen Voraussetzungen
integrativer Prozesse immer wieder thematisieren.
Gerade wegen der Vermittlung von Inklusionserfahrungen benötigt der Verein
noch mehr Eltern, die ihre Erfahrungen mit einbringen, um den Verein zu
stärken. Gerade in bezug auf das praktische Alltagshandeln zeigt die
Erfahrung in vielen Gesprächen, dass die Beteiligung der Elternselbsthilfe
an den Entwicklungsprozessen und zentralen Fragen unverzichtbare ehrenamtlich
geleistete Kompetenz bietet.
Es wird in der kommenden Arbeitsphase interessant sein, in einer vergleichenden Betrachtung unterschiedliche Organisationsmodelle zur Integration von Kindern mit Assistenzbedarf in den Kindergarten auch unter diesen Aspekten in ihren Möglichkeiten und Grenzen zu erfassen.
[1] Paulo Coelho: DIE ZEIT, Nr. 49, 29.11.01, S.80
[2] vgl. u.a. Stuttgarter Zeitung vom 22.01.2002
[3] defizitärer Sprachgebrauch ist bedauerlich
[4] Schon allein im Bereich der Wirtschaft stellt sich die Frage, ob eine Produktion in andere Länder zu verlagern und Billigtarife und Dumpingpreise aus ethischen und moralischen Grundsätzen nicht zu hinterfragen sind. Das kann hier nicht weiter vertieft werden, wirft aber auch Schatten auf den Bereich des Sozialen. Immer stärker werden hier Strategien des outsourcing verfolgt, um den Haushalt zu entlasten. Die Prozesse der ständigen Produktionsverlagerungen und Billigtarife ist nur ein Mosaikstein in einer immer stärker reduzierten kapitalorientierten Denkweise. Letztendlich wären notwendige Konsequenzen auf ganz anderen Spielfeldern zu ziehen. Als Beispiel kann hier die steigende Kluft zwischen Arm und Reich angeführt werden, zwischen Chefetage und Angestellten. Während vor 40 Jahren ein Chef durchschnittlich 45 mal mehr verdient hat wie ein Arbeiter klafft die Differenz heute z. T. um ca. das 5000-fache (vgl. Beat Kappeler: Werden die Armen immer ärmer". In: Die Weltwoche, Zürich 06/02).
"Ein Kindergarten für alle Kinder" - Zwischenbericht FaBi
2. Gesamtkonzeption - Beschreibung des Projekts
2.1 Kurze Beschreibung der Projektintention
Auf dem Hintergrund der positiven Entwicklungen im Bereich der Integration von Kindern mit Behinderungen im Kindergartenbereich in Baden-Württemberg (Kindergartengesetz, Umstrukturierung der Eingliederungshilfe) entwickelte die Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V. zusammen mit der Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg in Absprache mit Stadt und Landkreis eine Konzeption für einen Beratungs- und Assistenzdienst zur Unterstützung der Inklusion von Kindern mit Assistenzbedarf in Kindertagesstätten in Stadt und Landkreis Reutlingen (vgl. Projektkonzeption 2000).
Ausgangspunkt der Überlegungen waren die Erfahrungen der AGI in den letzten 20 Jahren, die zeigten, dass Integration in Einzelfällen im Kindergarten möglich war. Obwohl schon an anderen Orten vor Einführung der Eingliederungsrichtlinien die zuständigen Stellen in der Kommune bzw. im Landkreis gute Rahmenbedingungen für Integration im Kindergarten geschaffen haben, sahen wir hier in Reutlingen eine besondere Herausforderung, die Richtlinien zu erproben und für bessere Integrationsmöglichkeiten zu sorgen.
Das Bemühen um dieses Projekt war auch mit der Sorge verbunden, dass sich vor Ort, ohne eine Initiative von außen, wenig in Richtung Integration entwickeln würde. Diese eher pessimistische Einschätzung geht aus den jahrelangen Erfahrungen der AGI in den vor(schulischen) Lebensbereichen hervor. Rechtzeitig hat sich deshalb der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Integration in Zusammenarbeit mit der Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg um ein Modellprojekt bemüht, damit eine innovative Kraft im Landkreis integrative Überlegungen für den Vorschulbereich entwickelt.
Die bisherige Forschungspraxis bzw. durchgeführten Modellprojekte in den verschiedenen Lebensbereichen (z. B. Beschäftigung, Wohnen) waren ein wichtiger Bestandteil zur Praxisentwicklung. Wie in den bisherigen Projekten sehen wir auch mit dem Modellprojekt "Inklusion im Kindergarten" eine Herausforderung, einen Beitrag über den lokalen Bezug hinaus zu leisten.
2.2 Zielsetzung
Für das Modellprojekt wurden im Vorfeld (vgl. Projektkonzeption im Anhang) folgende Kernziele entwickelt:
-
ORGANISATION DER ASSISTENZ: Im Vordergrund steht die Gründung eines
unabhängigen Inklusionsfachdienstes, der die Assistenzaufgaben koordiniert
und begleitet, sowie die MitarbeiterInnen in Kindergärten und die Eltern
bei der Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen / Behinderungen in
allen Belangen unterstützt. Primäres Ziel ist der Aufbau eines
AssistentInnenpools und AssistentInnennetzwerks.
-
BERATUNG VON BETEILIGTEN: Neben der Organisation der Assistenz liegt ein
wichtiges Ziel in der Beratung von Eltern, ErzieherInnen, Trägern im
Vorfeld und in bestehenden Situationen, um Kindern mit und ohne Behinderungen
im Alltag angemessene Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen
und die Integrationsfähigkeit der Einrichtungen und des sozialen Umfelds
zu stärken.
-
KOOPERATION: Grundlegendes Verständnis des Assistenz- und
Beratungsdienstes ist dessen Einbettung in die vorhandenen und gewachsenen
Strukturen der Unterstützung. Eine Zusammenarbeit mit den Fachdiensten von
Kindergartenträgern, sonderpädagogischen und interdisziplinären
Frühförder- und Beratungsstellen sowie die Kooperation mit
heilpädagogischen Praxen und medizinischen Diensten ist Voraussetzung
für ein konstruktives und effektives Angebot. Ziel der Vernetzung ist es,
einen für das Kind und ihre Familie transparenten und zügigen
Entscheidungsprozeß zu erreichen und die unterschiedlichen
Unterstützungs- und Beratungsangebote im Sinne der
selbstverständlichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu nutzen.
-
ÖKONOMISCHE RAHMENBEDINGUNGEN DES FACHDIENSTES / WIRTSCHAFTLICHKEIT:
Aus ökonomischer Sicht besteht ein großes Interesse, den Fachdienst
so zu führen, dass die Wirtschaftlichkeit des Projekts erfüllt wird
und der Dienst sich nach spätestens drei Jahren selbst trägt. Unter
dieser Prämisse ergeben sich Fragestellungen, die sowohl die
Möglichkeiten der Eingliederungshilfe als auch die Höhe der
Fachleistungsstunden oder die Einstufung von AssistentInnen u.a. betreffen. Ein
Ziel des Projekts ist es deshalb, Rahmenbedingungen für die Organisation
und Begleitung von AssistentInnen zu schaffen bzw. zu nennen, unter denen die
Integration von Kindern mit Assistenzbedarf im Kindergarten ermöglicht
werden kann.
-
WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG: Die Erprobung des Modellprojekts wird im
Auftrag des Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Dabei sollen die Erfahrungen bei
der Umsetzung der Richtlinien dokumentiert und analysiert werden, damit die
Möglichkeiten und Grenzen, Veränderungen und
Widersprüchlichkeiten sichtbar werden.
2.3 Zielgruppen
Der Assistenz- und Beratungsdienst bietet für die unterschiedlichen Zielgruppen ein differenziertes Leistungsangebot an. Für Kindergartenträger organisiert er die Suche, Anstellung und Begleitung der AssistentInnen. In der Praxis ist die Beauftragung durch einen Kindergartenträger der letzte Baustein eines längeren Projekts und im wesentlichen mit formalen Inhalten verbunden. Die Weichen werden zuvor gestellt, so dass besonders die Kindergartenleitung, Frühförderstellen, Fachberaterinnen, Erzieherinnen, Eltern etc. - also eine vielfältige Gruppen von Beteiligten - im Vorfeld eine Kooperation mit dem Assistenz- und Beratungsdienst suchen. Diese Kooperation im Vorfeld von Entscheidungsprozessen legt eine breit angelegte Kooperation mit allen zuständigen Fachstellen im Kindergartenbereich nahe und bleibt auch während der Begleitung von Integrationssituationen im Kindergarten eine wichtige Basis.
Im Bereich der Aquise werden besonders Frauen angesprochen, die einen Wiedereinstieg in den Beruf bzw. in den Berufsalltag verfolgen. Im Rahmen der Möglichkeiten übernehmen die MitarbeiterInnen des Fachdienstes außerhalb ihres Dienstauftrags auch auch Fortbildungsangebote für ErzieherInnen im Kindergarten und für Erzieherinnen in Ausbildung.
2.4 Modellprojekt
Das Landesjugendamt Württemberg-Hohenzollern und das Landessozialamt haben auf
Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V. in Abstimmung mit
der Leitung der Sozialämter in Stadt und Landkreis beschlossen, diese
Richtlinien in Reutlingen modellhaft zu erproben. Dazu wurde zunächst ein
Beratungs- und Assistenzdienst (FABI) eingerichtet, der mit den
öffentlichen und privten Kindergartenträgern zusammenarbeitet.
"Ein Kindergarten für alle Kinder" - Zwischenbericht FaBi
3 Projektverlauf im Assistenz- und Beratungsdienst
- 3.1 Aktivitäten
- 3.2 Prozesse - Erste Erfahrungen
- 3.2.1 Organisation der Assistenz
- 3.2.2 Wirtschaftlichkeit
- 3.2.3 Institutionelles know how: arbeitsrechtliche und vertragsrechtliche Aspekte im Konstrukt der Eingliederungshilfen
- 3.2.4 Genehmigungsverlauf - Bearbeitungszeiten der Behörden
- 3.3 Kooperationserfahrungen
- 3.4 Öffentlichkeitsarbeit
- 3.5 Weiterführende Aspekte
3.1 Aktivitäten
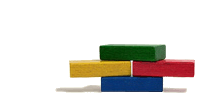
Im folgenden werden die Aktivitäten des Projekts im Verlauf dargestellt und
für das Jahr 2001 in drei Phasen untergliedert.
In der ersten Arbeitsphase des Projekts mussten mit Beteiligung der
wissenschaftlichen Begleitung drei wesentliche Aufgaben bewältigt
werden:
- Die Vorbereitung der MitarbeiterInnen auf das Arbeitsgebiet der Integration
im Kindergarten.
Hierzu gehörten die Vermittlung der Geschichte und Stand des Projekts bzw. der Prozesse, der gegenwärtigen Diskussionen und Vorgaben sowie die Einbindung in die Ziele und Inhalte des Trägers. Darüber hinaus konnten sich die Mitarbeiterinnen über Hospitationen in verschiedenen Kindergartengruppen über die Situation vor Ort detailliert informieren. Ziel dieser Einarbeitungs- und Konstruktionsphase lag in der Erarbeitung einer konsensfähigen Basis und Haltung zur Realisierung von Integrationsprozessen für Kindern mit Assistenzbedarf im Vorschulbereich. - Der Aufbau einer Verwaltung und einer Organisationsstruktur.
In den Räumen der Arbeitsgemeinschaft Integration mußte mit begrenzten Mitteln eine an heutigen Verhältnissen angepasste Büro- und Kommunikationsstruktur entwickelt und eingerichtet werden. Innerhalb des Projekts mußten die Aufgaben und Abläufe festgelegt werden, außerhalb die Kooperationen und Verantwortlichkeiten mit den verschiedenen PartnerInnen entwickelt und geklärt werden. - Vorbereitung der öffentlichen Präsentation des Projekts.
Für die ersten Schritte in die Öffentlichkeit wurden die zentralen Standpunkte, Aufgaben und Ziele für das Projekt erarbeitet und in einen Flyer umgesetzt. Weiterhin wurden die Vorgehensweise und Wege in die Praxis erarbeitet.
Die zweite Arbeitsphase bestand in den ersten Schritten in die Praxis:
Die Präsentation des Projekts in der Öffentlichkeit sowie die
schriftliche Vorstellung und Kontaktaufnahme mit möglichst vielen
potentiellen KooperationspartnerInnen. Zur gleichen Zeit begann die Vorstellung
des Projekts in den verschiedenen Fachstellen, Arbeitsgruppen und Gremien. Bis
heute ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen.
Mit dieser Phase begann auch die Suche nach Personen, die eine Assistenz
übernehmen könnten und in die Kartei des Assistenzpools mit
aufgenommen werden wollten. Über die ersten Kontakte zu Einrichtungen,
Eltern und Öffentlichkeitsarbeit etc. wurde auch die Suche nach
möglichen Integrationssituationen aufgenommen.
Die dritte Arbeitsphase kann als Beginn der konkreten Vermittlungstätigkeit bezeichnet werden. Nach den ersten drei Monaten kamen einzelne Anfragen zur Übernahme von Assistenzsituationen. Aufgrund der finanziellen Voraussetzungen des Projekts haben die Mitarbeiterinnen die ersten Assistenzstellen selbst übernommen, so dass ab Juli 2001 und September 2001 die Mitarbeiterinnen vier Stunden in der Woche Assistenz im Kindergarten leisten. Diese eigenen Praxiserfahrungen im Kindergarten sehen die Mitarbeiterinnen als eine wichtige Basis für die Beratungs- und Vermittlungsarbeit. Es bleibt aber offen, ob das Zeitbudget der Mitarbeiterinnen auf Dauer diese Assistenztätigkeit zulassen wird.
Von Monat zu Monat sind die Anfragen angestiegen, so dass die Abklärung
von Assistenzsituationen den Schwerpunkt der Arbeit bilden.
In dieser Phase haben auch die rechtlichen Fragen hinsichtlich der
unterschiedlichen Verträge viel Raum eingenommen.
Zentrale Aktivitäten auf einen Blick - eine Auflistung:
- Konzeption einer öffentlichen Präsentation des Projekts
- Entwicklung von Arbeitsverträgen von AssistentInnen
- Entwicklung von Beauftragungsverträgen mit Trägern
- Kontakt- und Kooperationsaufbau im Landkreis Reutlingen
- Erste Vermittlung von AssistentInnen
3.2 Prozesse - Erste Erfahrungen
3.2.1 Organisation der Assistenz
Wie in der Projektkonzeption erwähnt, sind in Reutlingen schon einige Kinder mit Assistenzbedarf vor der Einführung der Richtlinien in Kindergärten aufgenommen worden. Gleichzeitig wurden diese positiven Integrationsbeispiele im Kindergarten in den letzten Jahren nie zum Anlass genommen, sie für eine öffentlich formulierte Integrationspolitik in Stadt- und Landkreis zu nutzen. Die Erwartungen hinsichtlich einer gemeinsamen Basis für eine integrative Kindergartenausrichtung waren deshalb zu Projektbeginn gedämpft und stärker darauf fokussiert, Überzeugungsarbeit zu leisten.
In den Überlegungen der Projektentwicklung wurden schon frühzeitig
verschiedene Kooperationspartner auf eine Mitarbeit und Zusammenarbeit
angesprochen. Neben der Stadt, als größtem Kindergartenträger
in Reutlingen und dem Landkreis mit seiner Schlüsselfunktion betraf dies
noch freie Träger, die für die Unterstützung von Menschen mit
Assistenzbedarf zuständig sind. Neben einer grundsätzlichen
Gesprächsbereitschaft standen wir skeptischen Haltungen gegenüber,
die zum Teil aus den bisherigen schwierigen Erfahrungen mit der Organisation
von flexiblen AssistentInnen gesammelt wurden. Darüber hinaus gab es auch
Widerstände im Vorfeld, die sich vor allem auf die Kooperationsbedingungen
und Kooperationszusicherungen bezogen.
Mit dem Beginn des Assistenzdienstes im März 2001 hat sich relativ schnell
eine veränderte Situation und eine enge Kooperation mit der Fachberatung
der Stadt Reutlingen ergeben. Die Fachberatung der Stadt Reutlingen legt den
Kindergärten inzwischen nahe, bei konkreten Anfragen von Kindern mit
Behinderungen, die über die Richtlinien gefördert werden, FABI zu
engagieren.
In konkreten Zahlen hat sich bisher folgende Vermittlung ergeben: 15
AssistentInnen wurden in Stadt/Landkreis vermittelt, weitere stehen
demnächst an, so dass die zu Projektbeginn nicht abzuschätzende
Nachfrageentwicklung positiv verlief.
In der Regel verlaufen die Anfragen an FABI im Moment in ganz kurzfristigen
Zeitdimensionen. Die Vorabsprachen stehen meistens kurz vor dem Abschluß,
der Bescheid vom Amt ist die einzige Wartezeit. In dieser Spanne soll eine
kompetente AssistentIn gefunden werden, auch wenn die Rahmenbedingungen, wie
z.B. wieviel Stunden Begleitung in der Woche zur Verfügung stehen, noch
nicht bewilligt sind.
Bei einigen Anfragen wurde FABI mit Situationen konfrontiert, die auf
Vereinbarungen basierten, dass Kinder mit Assistenzbedarf nur mit der
AssistentIn den Kindergarten besuchen konnten. Die regulären Besuchszeiten
standen somit dem Kind und der Familie nicht zur Verfügung. Außerdem
mußte bei Krankheit der Assistentin das Kind auch zuhause bleiben. So
mussten wir in Einzelsituationen eine Beauftragung ablehnen. Ein Weg zur
Inklusion ist hier noch zu entwickeln.
3.2.2 Wirtschaftlichkeit
Eine
schwierige Frage war die Festlegung der Stundensätze, die den
Kindergartenträgern für die Bereitstellung der AssistentInnen
berechnet werden. Hier wurden wir mehrmals mit Vorstellungen z.B. von
TrägervertreterInnen einer großen Einrichtung konfrontiert, die
jenseits einer vertretbaren Größe lagen (12-15 DM pro Stunde).
Unsere eigenen Berechnungen lagen für Erzieherinnen etwa bei DM 70.-- und
orientierten sich an Erfahrungen in anderen Bereichen. Aus pragmatischen
Überlegungen und dem Wunsch, die erste Projektphase nicht am Geld
scheitern zu lassen, haben wir uns nach langem Ringen in der Projektgruppe
für einen Einstiegssatz von DM 50.- geeinigt, was nur durch die
Zuschüsse der "Aktion Mensch" möglich ist. Mitte des Jahres werden
wir anhand der Datenerhebung erkennen können, welcher Satz notwendig
wäre, um kostendeckend zu arbeiten.
Eine wirtschaftliche Betrachtung der Pauschalen läßt noch viele
Fragen offen: Was kann mit den Eingliederungshilfen finanziert werden?
Ausschließlich die Assistenzstunden? Wer finanziert die Beratung? Welchen
Beitrag könnten andere Stellen leisten, um einen Assistenzdienst zu
finanzieren?
Die Auswirkungen dieser schwierigen Finanzierungssituation führten in der
Anfangsphase des Projekts bei den MitarbeiterInnen des Assistenz- und
Beratungsdienstes zu Sorgen um den Erhalt des Projekts und um die Sicherung der
eigenen Stellen. Zudem wurde zu Beginn des Projekts durch die Einarbeitung, die
Öffentlichkeitsarbeit u.a. über einen längeren Zeitraum keine
Einnahmen erzielt und somit die Geduld und Zuversicht schon auf eine harte
Probe gestellt. Mit dem Rücken zur Wand - so kann die erste Phase des
Projekts für die Mitarbeiterinnen und den Vorstand beschrieben werden.
Weil sich u.a. die Zahl der Anfragen erhöht hat, sehen die
Mitarbeiterinnen sowie der Träger zwar immer noch die Finanzunsicherheit,
aber sie erhält keine dominante Stellung im Alltag. Die Vermittlungsquote
der AssistentInnen hat einen positiven Effekt erzeugt, so dass die
wirtschaftliche Frage weniger vom Bedarf und der Nachfrage abhängt,
sondern grundsätzlich von der Finanzierung der realen Kosten eines
Beratungsdienstes.
Hier sind aus der Sicht aller Beteiligten -wissenschaftliche Begleitung,
MitarbeiterInnen, Träger- noch wichtige Fragen zu klären: Wie
können die Fixkosten einer Organisation, die qualitative Assistenz
vermittelt und somit auch im hohe Maße mit Beratungsaufgaben konfrontiert
ist, finanziert werden?
Wir haben deshalb begonnen, exemplarisch einzelne Situationen von Beginn an mit
zeitlichem Aufwand in den einzelnen Bereichen zu erfassen, um am Ende den
Aufwand dokumentieren und Fragen nach der Finanzierung diskutieren zu
können. Es zeichnet sich dabei ab, dass schon in der Klärungsphase im
Vorfeld bei einigen Situationen sehr viel Zeit investiert werden muss, bevor
das Kind die erste Stunde im Kindergarten verbringen kann.
3.2.3 Institutionelles know how: arbeitsrechtliche und vertragsrechtliche Aspekte im Konstrukt der Eingliederungshilfen
Die Eingliederungshilfen in Form von Pauschalen lassen eine arbeitsrechtliche Gestaltung von Anstellungsverhältnissen offen. Das hat den positiven Effekt, dass bei der Suche nach AssistentInnen verschiedene Personengruppen für diese Arbeit gewonnen werden können.
Diesen offenen Vorgaben stehen große Umsetzungsprobleme bei der
Gestaltung von Arbeitsverträgen mit AssistentInnen gegenüber, die
sich aus gesetzlichen Vorgaben ergeben. Um dies zu verdeutlichen, ein Beispiel:
In der ersten Phase der Vertragsentwicklung für AssistentInnen sind wir
davon ausgegangen, dass wir den Assistentinnen den gleichen Status wie
ErzieherInnen einräumen, um eine Gleichstellung herzustellen und Unter-
bzw. Überordnungen zu vermeiden. In der Konsequenz bedeutet dies aber auch
einen Abschluß mit BAT-Konditionen. Der Vertragsentwurf wurde von
verschiedenen Seiten begutachtet, wobei die Einschätzungen von ExpertInnen
sehr unterschiedlich ausfielen. Nach langen Verhandlungen sind wir zu der
Konsequenz gekommen, dass ein Arbeitsvertrag im Bereich der
Eingliederungshilfen zwar eine Gehaltsanlehnung an BAT ermöglicht, aber
der BAT radikal aus dem Vertrag genommen werden muß. Verträge, die
sich auf den BAT beziehen und Regelungen wie z.B. besondere Gratifikationen,
Fortbildung etc. ausschließen möchten, müssen alle
Möglichkeiten den BAT schriftlich ausdrücklich herausnehmen - ein
schwieriges Unterfangen. Mit diesem Beispiel soll verdeutlicht werden, dass die
Handhabung der Rechtsprechung sehr unterschiedlich ist, so dass keine
eindeutigen Regelungen übernommen werden können. Der bisherige
Aufwand bestätigt, dass die Abnahme der Anstellungen von Assistentinnen
für die Träger eine große Entlastung darstellt.
Viele Träger sehen in der Kooperation mit FABI die Möglichkeit, ohne
den bisherigen Verwaltungsaufwand und die mit der Anstellung vorhandenen
Risiken, Integration im Kindergarten zu ermöglichen. In Vorgesprächen
mit Trägern hat sich gezeigt bzw. zeigt sich, dass viele Träger auf
den Wunsch nach Eingliederung von Kindern mit Assistenzbedarf zögernd bzw.
abwehrend reagier(t)en, weil u.a. der Verwaltungsaufwand und das Risiko bei der
Einstellung, Abwicklung und Weiterbeschäftigung von AssistentInnen sehr
hoch ist. Letzteres immer auch vor dem Hintergrund, dass bei wiederholten
Weiterbeschäftigungen evt. die Kettenverträge als rechtlich
unzulässig gelten könnten und eine Klage auf Festeinstellung ein zu
hohes Risiko darstellt. Wenn also schon große Träger - die
alltäglich mit Einstellungen, Eingruppierungen, rechtlichen Fragen
konfrontiert sind - bei der Assistenz an Grenzen kommen, ist es für einen
kleinen Verein unter den gegebenen Bedingungen ein Erfolg, hier diese Aufgaben
bewältigen zu können.
In diesem Aufgabengebiet konnte durch die Kooperation mit der
Gustav-Werner-Stiftung zum Bruderhaus Reutlingen ein kompetenter Partner
gefunden werden, der die Einstellungsformalitäten, Gehaltsberechnungen und
-abrechnungen für die AGI mitabwickelt.
Trotz dieser Unterstützung war es notwendig, relativ viel Zeit in
rechtliche Fragestellungen zu investieren. Aus den bisherigen Erfahrungen kann
aus der Projektverwaltung nur empfohlen werden, eine Rechtsberatung bei der
Gestaltung von Arbeitsverträgen mit einzubeziehen.
Trägerverträge
Im Vorfeld der Assistenzvermittlung stehen die Projektmitarbeiterinnen auch Trägern gegenüber, die ihre wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund stellen und Vertragsveränderungen einfordern. Mit der Haltung "wie kann ich möglichst wenig bezahlen" beschreibt eine Mitarbeiterin von FABI den Kampf um die Vertragsgestaltung. Dabei geht es vor allem um Situationen wie Krankheit des Kindes oder der AssistentIn und Bezahlung in den Ferien. Hier sehen wir zum einem einen enormen Bedarf an Vermittlung integrativer Inhalte, wie z. B. die Voraussetzung, dass das Kind auch in Zeiten, in denen keine Assistentin zur Verfügung steht, den Kindergarten besuchen kann oder dass bei kurzfristiger Krankheit des Kindes die Assistentin sinnvollerweise trotzdem ihre Stunden in der Gruppe verbringt. Zu klären bleibt noch, welche Möglichkeiten der Dienst bei längerer Krankheit der Assistentin anbieten kann.
Obwohl die Träger mit Vertragsabschlüssen vertraut sind, zeigen die
bisherigen Erfahrungen, dass wir hier bei einzelnen Partnern viel
Aufklärungsarbeit leisten müssen. Hierzu Beispiele: Bei einigen
Trägern muss der Dienst über Monate auf die Überweisung der
Eingliederungshilfen warten. Obwohl die unterzeichnete Beauftragung einen
rechtsverbindlichen Vertrag darstellt, versuchen einige Träger die
Vereinbarungen zu übergehen. Die Mitarbeiterinnen sehen sich hier einem
Legitimationsdruck ausgesetzt, weil gerade von Verwaltungsseite ein Wissen um
indirekte Leistungen aus ihren eigenen Erfahrungen bekannt ist, aber diese dem
Dienst nicht zugestanden werden. Deshalb wird das bisherige
Trägermerkblatt, in dem die wichtigsten Vertragsabläufe,
Zuständigkeiten und Bedingungen angesprochen sind, noch um ein Info
über die speziellen Leistungen des Dienstes ergänzt.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass qualitative Aspekte in der
Organisation und Bereitstellung von Inklusionsassistentinnen im Vordergrund
stehen. Dazu gehört, dass
- auf die Kontinuität der InklusionssassistentInnen Wert gelegt wird, damit eine zuverlässige Begleitung und Unterstützung wohnortsnah gewährleistet werden kann.
- eine qualifizierte MitarbeiterIn die Mitarbeit und Unterstützung hin zur Inklusion ermöglicht.
- eine spezifische Qualifizierung im Bereich der Inklusion die Motivation erhöht und Kompetenz der InklusionsassistentInnen erweitert.
- die Begleitung der AssistentInnen durch den Assistenz- und Beratungsdienst im Alltag eine Beratung mitbeinhaltet.
Ein Ziel muss auch darin liegen, die Träger in die Verantwortung zu nehmen. Deshalb dürfen nicht alle Leistungen und die Verantwortung nach dem derzeitigen mainstream "outsourcing" an den Dienst abgegeben werden. Dies lässt sich nur verwirklichen, wenn die Träger über community care oder sonstige Kooperations- und Zielvereinbarungen mit in die Verantwortung genommen werden. D.h. es braucht hier eine gemeinsame Zielvereinbarung mit den Trägern über Leistungen und Kostenverteilung.
Vertragsgestaltungen mit AssistentInnen
In der Regel haben die AssistentInnen aufgrund ihrer Lebenssituation einen
Anspruch auf einen regelversicherungspflichtigen Anstellungsvertrag.
Honorarverträge können vor dem Hintergrund der rechtlichen Vorgaben
bei dem Status der Assistentinnen in der Regel nicht abgeschlossen werden.
Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der
GeringverdienerInnen-Vergütung zeigen bei diesem Vertragsabschluß
auch Schwachstellen, die bedenkenswert erscheinen. Die
Freistellungserklärung des Finanzamts reicht eigentlich für einen
Vertragsabschluss aus, kann aber in Einzelfällen aufgrund von
persönlichen Einkünften, z. B. aus Mietverhältnissen, eine
Versicherungspflicht nicht ausschließen. Von der Assistentin muss
eigentlich zur klaren Absicherung eine Eigenerklärung unterschrieben
werden, in der sie versichert, dass sie keine persönlichen Einkünfte
hat. Bei Falschangabe besteht dann eine Schadenersatzverpflichtung über
die Höhe der Versicherungsbeiträge, die über den
zivilrechtlichen Weg vom Dienst eingeklagt werden kann.
3.2.4 Genehmigungsverlauf - Bearbeitungszeiten der Behörden
Aus
den bisherigen Rückmeldungen von Trägern und Erzieherinnen wird die
Bearbeitung der Anträge zu Eingliederungshilfen seit der Einführung
der Richtlinien und der Zuständigkeit des Landeswohlfahrtverbands positiv
beschrieben.
Die Bearbeitungszeit ist wesentlich kürzer. Dies bestätigt sich auch
außerhalb unseres Landkreises. Während es früher bis zu
eineinhalb Jahren dauern konnte, bis die Eingliederungshilfen genehmigt wurden,
geht es heute innerhalb von den drei Monaten, die ja inzwischen gesetzlich
vorgeschrieben sind.
Bei der Beantragung von Eingliederungshilfen können wir aus unseren bisherigen Erfahrungen diese positiven Veränderungen tendenziell bestätigen. Wenn Verzögerungen eintreten, liegen sie eher am Sozialamt des Landkreises.
3.3 Kooperationserfahrungen
Vom
ersten Gespräch an verlief die Kooperation mit der
interdisziplinären Frühförderstelle sehr konstruktiv. In
einem gemeinsamen Treffen wurde offen über die Situation im Landkreis
informiert. Über die jeweiligen originären Arbeitsbereiche der
Dienste sowie über die Haltung zur Integration bestand eine hohe
Übereinstimmung. Die vielfältigen Erfahrungen der
interdisziplinären Frühförderstelle in integrativen Situationen
sind unter zwei Aspekten für den Start des Projekts besonders interessant.
Zum einem kommt die interdisziplinäre Frühförderstelle auf dem
Hintergrund ihrer eigenen Geschichte zur Einschätzung, dass in der
Vergangenheit der Landkreis Reutlingen in bezug auf Integration ein
"schwieriges Pflaster" darstellte, jedoch durch die neuen Richtlinien eine
Veränderung möglich scheint. Zum anderen wird nochmals die
Problematik von Kindern aufgegriffen, die nur stundenweise mit der Assistentin
kommen können. Es besteht hier die Gefahr, dass integrative Ansätze
gleich auch wieder Ausgrenzung mitkonstruieren. Aus der Sicht des betroffenen
Kindes kann, wie es eine Mitarbeiterin formulierte, das Gefühl entstehen:
"Ich scheine im Kindergarten zuviel zu sein".
Die gute Zusammenarbeit spiegelt sich auch in konkreten Alltagssituationen und
einem regelmäßigen Austausch wider.
Bei den Frühberatungsstellen im Landkreis sind stärkere Widerstände und Ängste gegenüber dem Projekt und dessen Zielen in den Gesprächen sichtbar. Vor allem bestehen die Sorgen darin, dass durch die Integration in den Regelkindergarten bei den Eltern Erwartungen geweckt und unterstützt werden, die zu Überlegungen nach Fortsetzung der Integration in die Regelschule führen und den Bestand der Sonderschule gefährden könnten. Darüber hinaus bestehen auch Bedenken, dass die Zuständigkeit und ein Arbeitsfeld wegfallen könnten und somit auch Einflußmöglichekeiten verloren gehen.
Eine positive Haltung von einigen Mitarbeiterinnen der Frühförderstellen gegenüber dem neuen Dienst FABI zeigt sich darin, dass sie es begrüßen, endlich eine Stelle zu haben, die für die Suche und Begleitung der AssistentIn verantwortlich ist und somit auch Unterstützung und Entlastung für die eigene Arbeit bietet.
Im Bereich der Fortbildung kam es schnell mit dem Landkreis
unverzüglich zu einer Kooperationsvereinbarung. Mit der Fachberatung wird
in diesem Jahr eine Fortbildung für "Tandems" - Erzieherinnen und die
jeweiligen InklusionsassistentInnen - angeboten.
Nur in Ansätzen entwickelt ist ansonsten die Kooperation mit den
zuständigen Stellen des Landkreises aufgrund von strukturellen
Veränderungen, nicht besetzten Stellen in der
Kindertagesstättenfachberatung des Landkreis etc. Die Handhabungen in
bezug auf den §35a KJHG sind noch nicht festgelegt, so dass hier noch
Entscheidungen abgewartet werden müssen. Die Zielgruppe der sogenannten
Kinder mit "seelischer Behinderung" wird bisher kaum nachgefragt. Seit kurzem
gibt es im Projekt eine Anfrage.
Für die Beratung für Träger im Landkreis in bezug auf die
Eingliederungshilfen gibt es einen Ansprechpartner.
In der Vermittlung von integrativen Situationen im Kindergarten ist aus Sicht
des Assistenz- und Beratungsdienstes eine Intensivierung der Kooperation
erwünscht.
Die Gespräche mit einer Vertreterin des Gesundheitsamtes bestätigen die positiven Rückmeldungen von Eltern und Beratungsstellen hinsichtlich der Kooperation und Unterstützung bei der Abwicklung des Formblatts A. Die Transparenz gegenüber allen Beteiligten sowie die zügige Bearbeitung werden geschätzt.
Fachberaterinnen äußern sich positiv über die Entlastung bei der Gestaltung des Abklärungsprozesses im Vorfeld sowie bei der ständigen Begleitung während der Gewährung von Eingliederungshilfen. Das beginnt bei der Suche nach AssistentInnen über die Vorgespräche mit den jeweiligen Gruppen bis hin zu den Regelungen zwischen den Erzieherinnen und AssistentInnen.
Ein strukturelles Problem für die Fachberaterinnen besteht ohne einen
zusätzlichen Dienst wie FABI darin, dass sie neben der fachlichen
Zuständigkeit auch durch ihre übergeordnete Eingebundenheit in die
Entscheidungsstrukturen bei Konflikten in doppelten Funktionen wahrgenommen
werden. Die Abgabe der Anstellungsverantwortung und Dienstaufsicht an FABI
löst strukturelle Rollenkonflikte und bietet somit eine bessere Basis der
jeweiligen Interessenvertretung.
Eine Fachberaterin zeichnet aus der bisherigen Begleitung der Assistentinnen
folgendes Bild: Die Assistentinnen schwimmen oft durch ihre schwierige und
nicht eindeutig festgelegte Rolle zwischen zwei Positionen: Der Auftrag wird
ausschließlich auf das Kind bezogen und für die Gruppe wird keine
Verantwortung übernommen oder aber die Assistentin begreift sich als Teil
der Gruppe und des Teams. Die Erwartungen der Gruppenerzieherinnen spiegeln
ebenso dieses Spannungsfeld, so dass immer wieder Konflikte auftauchen, wie z.
B. ob die Assistentin bei einer Gruppenaktion wie das Laternenlaufen mit geht
oder ob sie nur in Einzelsituationen arbeitet. Hier können sehr
unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. Jegliche Einmischung der
Assistentin kann z. B. zuviel werden.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass eine Begleitung der Assistentin von
allen Beteiligten erwünscht ist.
Die Kooperationserfahrungen mit den ErzieherInnen werden von den
Mitarbeiterinnen des FABI überwiegend positiv eingeschätzt.
Während in der einjährigen Vorlaufphase des Projekts immer wieder
davon die Rede war, dass die ErzieherInnen in den Einrichtungen vor allem die
Erwartung haben, dass viele Assistenzstunden gewährt werden, kann dies aus
der Erfahrung der bisherigen Praxis nur beschränkt bestätigt werden.
Die erwarteten Konflikte blieben aus. Es zeigt sich bisher eine große
Bereitschaft der ErzieherInnen zur Umsetzung der Richtlinien, auch wenn sich
die Wochenstunden der Assistenz in Grenzen halten. Runde Tische tragen in der
Regel dazu bei, dass die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund
gestellt werden und rein stundenbezogene Betrachtungen außen vor bleiben.
Ein weiteres Indiz für eine positive Entwicklung liegt in dem
artikulierten Fortbildungsinteresse von Erzieherinnen.
AssistentInnen in Kindergärten, die nicht über das Projekt angestellt sind, wenden sich an FABI und signalisieren Bedarf an Austausch. FABI wird deshalb in den nächsten Monaten Austauschmöglichkeiten in Gruppen einrichten, um diesem Bedürfnis nachzukommen. Die FABI-Mitarbeiterinnen nennen für diesen Bedarf folgende Gründe: Obwohl die Assistentinnen mit den Erzieherinnen in den Gruppen arbeiten, sind sie aufgrund ihres Status "Einzelkämpferinnen". Dies liegt daran, dass die Rolle der Assistentin im Team nicht klar bestimmt ist und dieses neue Feld mit Unsicherheiten verbunden ist. Der Kindergarten und auch die Assistentinnen haben oft noch keine klare Vorstellungen ihrer Aufgabe. Hier besteht eine gemeinsames Anliegen im Team, Strukturen und Inhalte zu formulieren und transparent zu machen (vgl. auch Fachberaterinnen).
Das Kooperationsangebot an die Eltern wird aufgrund der
Trägerkonstruktion Elternorganisation gut angenommen. Viele Anfragen
kommen von Eltern, auch Anfragen, die sich nicht nur auf den Kindergarten
beschränken. Wünschenswert wäre von Seiten der MitarbeiterInnen
des Beratungs- und Assistenzdienstes eine intensivere Arbeit mit Eltern, auch
mit Eltern von Kindergartenkindern ohne Behinderungen.
Nach den ersten öffentlichen Darstellungen des Projekts entwickelte sich
eine Kooperation mit der Fachschule für Erzieherinnen in
Reutlingen. Integrationspädagogik soll als ein Schwerpunkt in der
Ausbildung etabliert werden. Die Mitarbeiterinnen des FABI übernehmen die
inhaltliche Gestaltung des Seminarangebots. Aufgrund von zeitlichen
Kapazitäten musste diese Aufgabe außerhalb des Dienstauftrags gelegt
werden.
Diese Verankerung des Inklusionsthemas im Bereich der Ausbildung erachten wir
als eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung des
Kindergartens zu einer Einrichtung für alle Kinder.
Im Bereich der Schule kam es zu verschiedenen Anfragen an das Projekt.
Die ersten Anfragen bezogen sich auf Eingliederungshilfe und Assistenz in
Förderschulen. Hier hat die Arbeitsgemeinschaft Integration als
Träger des FABI zurückhaltend reagiert, weil sich diese
Integrationsaufträge nicht auf eine Regeleinrichtung beziehen.
Seit kurzem ist von FABI eine schulische Integrationssituation übernommen
worden. Die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sind schwierig, so dass
bisher eine positive Entwicklung noch nicht vorherzusehen ist.
Wir gehen davon aus, dass die Anfragen nach Eingliederung in die Grundschulen
zunehmen werden, sehen aber einen grundsätzlichen Klärungsbedarf bei
der Beauftragung des Dienstes und bei der Kooperation mit den Schulämtern,
damit eine Basis für integrative Schulpolitik möglich wird. Die
positiven Ergebnisse integrativer Schulpolitik der Pisa-Studie könnten
eine weitere Ermutigung sein, um integrative Erziehung zu etablieren (vgl.
Kapitel Aktueller Diskurs).
In finanzieller Hinsicht erhofften wir uns auf der kommunalpolitischen Ebene über einen Antrag zur Gewährung von "Offenen Hilfen" - für die Beratungsarbeit - Unterstützung von Stadt und Landkreis. Aufgrund des Projektcharakters möchten die Parteien aber keine Hilfen gewähren, um somit den tatsächlichen Aufwand für die Organisation eines Assistenzdienstes nicht zu verschleiern. Grundsätzlich wird die Arbeit des Projekts aber sehr positiv wahrgenommen und gewürdigt.
Darüber hinaus wurden mit vielen anderen Diensten in und außerhalb des Landkreises Kooperationsgespräche geführt. Dazu zählen u.a. Kinderkliniken, Lebenshilfe (Kaffehäusle/FEDER), Fachschulen für ErzieherInnen, heilpädagogische Fachdienste, Kinder- und Jugendpsychatrie.
3.4 Öffentlichkeitsarbeit
Unabhängig vom Projekt sehen wir in der Öffentlichkeit durch die Einführung der Richtlinien einen regen Zuwachs des Interesses an dem Thema Integration im Kindergarten. Dies zeigt sich auch an der starken Nachfrage im Bereich der Qualifizierung von Erzieherinnen und Assistentinnen und an den vielen Anfragen aus ganz Baden-Württemberg. Sichtbar wird das Interesse an dem Thema auch an Fortbildungsveranstaltungen zur Integration im Kindergarten in den verschiedenen Fortbildungsprogrammen in Baden-Württemberg.
Vor Ort ist das Projekt nach der konstituierenden Phase zunächst mit einer
Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gegangen.
In einem Informationsschreiben wurden alle Träger von
Kindergarteneinrichtungen, Fachdiensten für Kindergärten und
sonstigen Diensten im Vorschulbereich, wie z. B. Kinderarztpraxen angesprochen.
Beiliegend zu den Schreiben erhielten sie noch zur Verbreitung Flyer des
Dienstes. Die Kindergartenträger wurden gebeten, die Informationen an die
ErzieherInnen weiterzuleiten und bei Bedarf den Dienst in Anspruch zu nehmen.
Gleichzeitig wurde ein Informationsgespräch angeboten. Auf den Brief kamen
umgehend einzelne Anfragen.
Bei einer weiteren telephonischen Kontaktaufnahme zur Nachfrage über den
Bedarf wurde Interesse am Dienst geäußert, Interesse an weiteren
Informationen bekundet und bisherige positive Erfahrungen vermittelt. Bei
einigen Trägern so die Rückmeldung, seien die Informationen
allerdings auch untergegangen.
Die Informationsrunden mit FachberaterInnen im Landkreis und Gesprächen
mit Interessierten aus Württemberg-Hohenzollern hatten das Ziel, den
Dienst bekannt zu machen und Erfahrungen auszutauschen. Die Vorstellungen in
regionalen Arbeitskreisen von Erzieherinnen sind noch nicht abgeschlossen.
Dieser "direkte Draht" zu Erzieherinnen wird von den Mitarbeiterinnen sehr
positiv bewertet, weil in diesen Gesprächen detailliert das Anliegen
vorgestellt werden kann und die Erzieherinnen ihre bisherigen Erfahrungen mit
integrativen Situationen einbringen.
Die Größe des Landkreises zeigt Grenzen einer direkten
Informationspolitik auf. Obwohl über Zeitungsartikel, gezielte
Informationsbriefe an Träger oder Vorstellung des Dienstes in regionalen
Arbeitskreisen der ErzieherInnen positive Effekte erzielt werden, wäre
eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit wünschenswert.
Ein interessanter Effekt entstand durch den nicht alltäglichen Gebrauch
des Begriffs Inklusion, der aus dem europäischen Diskurs übernommen
wurde. Im Projekt selbst gab es zunächst einigen Widerstand, weil der
Begriff nicht geläufig ist, nicht verstanden wird, Fremdwörter auch
eine Sprachdominanz präsentieren, die andere Personen in die Rolle der
Unwissenden setzen können etc. Ein weiteres Gegenargument hieß: wir
sind doch im Moment ganz froh, dass sich viele Beteiligte gerade an den Begriff
der Integration gewöhnt haben.
Unsere AssistentInnen, die bisher z. B. EingliederungshelferIn, StützpädagogIn u.ä. heißen, nennen wir "InklusionsassistentIn" und sehen als Eingliederungsaufgabe die Inklusion im Kindergarten.
Zwei interessante Konsequenzen sind zu verzeichnen, die von allen Beteiligten an den Re-Konstruktionsgesprächen geteilt werden. Einerseits schafft der doch oft unbekannte Begriff der Inklusion Gesprächsbedarf, so dass damit ein Einstieg in grundlegende Vorstellungen von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Kindern mit Assistenzbedarf in Gang kommt. Andererseits ermöglicht der Begriff, Vorstellungen über Inklusion zu thematisieren und in der Regel stößt die Auseinandersetzung auf Interesse. Teilweise wird der Sprachgebrauch des Inklusionsbegriffs auch belächelt oder mit dem Argument der Sprachbarriere abgelehnt.
Eine andere wichtige Frage kommt bei den Frauen (Männer haben sich bisher
noch nicht als AssistentInnen gemeldet) auf, die die Assistenz übernehmen.
Was heißt es InklusionsassistentIn zu sein?
Die Präsenz und Darstellung in den Tageszeitungen hat dazu geführt,
dass auch Eltern direkt auf den Dienst zukommen und ihren Beratungsbedarf
formulieren. Einige Eltern haben auch Anfragen in Bezug auf den schulischen
Bereich. Hier sehen wir vorläufig wenig Möglichkeiten, den Eltern
eine konkrete Perspektive aufzuzeigen.
Die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen bei Runden Tischen oder in regionalen
Arbeitskreisen zeigen, dass eine hinreichende Information über die
Möglichkeiten der Eingliederungshilfen noch nicht bei allen direkt
Beteiligten angekommen ist. Eine intensive Informationspolitik ist deshalb nach
wie vor notwendig.
Als einen ersten Schritt dazu haben wir eine homepage www.kigafueralle.de eingerichtet, in der neben dem aktuellen Stand im Projekt, Literatur etc. auch eine Vernetzung der Erfahrungen in Baden-Württemberg aufgebaut werden soll und sich jede Person von außen an einem Diskussionsforum beteiligen kann.
3.5 Weiterführende Aspekte
Konstrukt Eingliederungshilfe (Richtlinien für den Kindergarten)
Das Konstrukt Eingliederungshilfe geht von der besonderen Situation von Kindern mit Assistenzbedarf aus, die deshalb im Kindergarten besonderen Unterstützungsbedarf benötigen. Dieser Ansatz des Besonderen hat einerseits eine individuelle Seite, die der Unterschiedlichkeit von Lebenslagen gerecht wird. Andererseits besteht eine Gefahr aber auch darin, dass Kinder mit Assistenzbedarf besondere Voraussetzungen benötigen. Sie müssen verschiedenen Stationen durchlaufen, Gutachten und Empfehlungen erhalten, damit sie die Erlaubnis bekommen, Regeleinrichtungen zu besuchen. Diese Realitäten können für das Kind und die Eltern eine demütigende Situation schaffen. Ohne dass irgendein Gespräch oder eine Anfrage gestartet ist, gibt es ein Moment der Angst: "Darf mein Kind in den Kindergarten?" "Ist mein Kind integrierbar?" "Sind die Erzieherinnen und der Träger offen bzw. überhaupt in der Lage mit der Situation umzugehen?"
All diese Unsicherheiten, Abhängigkeiten und Besonderheiten ziehen die
Frage nach sich, wie die Eingliederungshilfe konstruiert sein und in das
Kindergartensystem eingebunden werden könnten, damit sich der Weg "ein
Kindergarten für alle" entwickeln kann. Was sind mögliche Schritte,
um die Integration und Inklusion von Kindern mit Assistenzbedarf als
gleichwertige und gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft, in der
Gemeinde und in dem Stadtteil voranzutreiben und sich das Besondere nur auf die
Frage bezieht, ob die vorhandenen Strukturen ergänzt werden müssen
oder Umstellungen im Kindergartenalltag nötig werden?
An verschiedenen Stellen ist schon angeklungen, dass für die Etablierung
eines integrativen Kindergartens neben den Rahmenbedingungen noch viele
bewußtseinsbildende Prozesse zum Verständnis von Inklusion
entwickelt werden müssen.
Die Richtlinien setzen ein hohes Maß an selbstverantwortlichem Handeln
der Träger voraus. Dies ist angezeigt; aber an den Diskussionen um reale
Integrationssituationen lässt sich erkennen, dass hier Investitionen
nötig sind.
Eigentlich kann es nicht angehen, dass in manchen Kindergärten
selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass ein Kind nur dann kommen
kann, wenn die AssistentIn auch im Kindergarten ist. Hier wirken die
gängigen Konstruktionsbilder von Normalität und Behinderung.
Gleichzeitig erleben wir einen Ort weiter eine Kindergartengruppe, den ein Kind
mit Assistenzbedarf ohne zusätzliche personelle und finanzielle Mittel wie
jedes andere Kind besuchen kann und erst durch die Richtlinien eine
Unterstützung in Anspruch genommen wird. In diesem Spannungsfeld bewegt
sich der Dienst.
Projektinterne Perspektiven
Eine zentrale Frage für das Jahr 2002 besteht in der Herausforderung, 40% der Personalkosten für die Mitarbeiterinnen des Projekts zu erarbeiten. Im Moment sehen wir durch unsere Kalkulationen eine realistische Chance, diesen Eigenanteil finanzieren zu können.
Innerhalb unserer eigenen Strukturen ist festzustellen, dass eine Stelle
"Projektmanagement" fehlt, die sich ausschließlich um die Belange der
Organisationsentwicklung, der Finanzierung und des Managements kümmert.
Wie in vielen Projekten ist dazu keine Finanzierung zu bekommen. Dabei besteht
die Gefahr, dass eine Erfahrung vieler Projekte wiederholt wird, Organisation
von Projekten wird nicht finanziert und der wissenschaftlichen Begleitung
übertragen und somit auch die Zeit von Begleitforschung verkürzt.
Einige Vorhaben für das erste Jahr - wie z. B. die Kooperation mit anderen
Landkreisen, konnte aufgrund der vielen arbeitsrechtlichen und vertraglichen
Abklärungsprozesse sowie der Schwierigkeiten bei der Etablierung des
Qualifizierungsprojekts noch nicht durchgeführt werden und müssen
deshalb für Anfang 2002 vorgesehen werden.
Eckpunkte zum Grundverständnis von InklusionsassistentInnen
-
Die InklusionsassistentIn arbeitet in der Gruppe, begleitet das Kind
und unterstützt das Team bei der Planung und Gestaltung inklusiver
Situationen. Die ErzieherIn hat die Verantwortung für alle Kinder. Sie
darf nicht an die InklusionsassistentIn delegiert werden.
è Die InklusionsassistentIn versucht in Zusammenarbeit mit den ErzieherInnen, anderen Fachkräften und den Eltern das Verhalten der Kinder zu verstehen, zu erklären und entsprechende Entwicklungsschritte anzubahnen. -
Die InklusionsassistentIn stärkt zusammen mit anderen Beteiligten
das soziale Netzwerk des Kindes in und außerhalb des Kindergartens, weil
die Qualität des Beziehungssystems sein emotionales Gleichgewicht, sein
soziales Verhalten und seine Motivation zum Lernen bestimmen.
-
Die InklusionsassistentIn benötigt dafür u.a. folgende
Qualifikation: ein entsprechendes Verständnis der Lebenslage Behinderung,
eine sensible Wahrnehmungsfähigkeit, fachliche (z. B.
enwicklungspsychologische, integrationspädagogische) und
kommunikativKompetenzen, sowie die Bereitschaft zur (Selbst-)Reflexion.
(Projektinternes Grundlagenpapier 2/2002)
"Ein Kindergarten für alle Kinder" - Zwischenbericht FaBi
4. Entwicklungen außerhalb des Landkreis Reutlingen Regionale Veranstaltungen des LWV
- 4.1 Partizipation der Praxis - Zur konzeptionellen Gestaltung des Erfahrungsaustauschs in den Regionen des Landwohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern
- 4.2 Erfahrungen der TeilnehmerInnen
- Arbeitsrechtliche Fragestellungen
- Kindergartenträger
- Personeller Einsatz der AssistentIn und Besuchszeiten des Kindes
- Definition und Förderung von Integrationsgruppen
- AssistentInnen
- Verfahrensformen: Entscheidungsstrukturen und -prozesse
- Beantragungszeit
- 4.3 LWV-Politik - Integrativer Transfer in die Politik
- 4.4 Fazit zu den Veranstaltungen
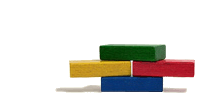
Im folgenden werden die Diskussionen von zwei regionalen Veranstaltungen des LWV dargestellt, die einen ersten Einblick über die Erfahrungen mit den Richtlinien an anderen Orten ermöglichen. Von Seiten der wissenschaftlichen Begleitung wurden Gespräche mit einigen ExpertInnen aus Baden-Württemberg geführt, die am Ende des Projekts über eine "Landesschau" mit einbezogen werden.
4.1 Partizipation der Praxis - Zur konzeptionellen Gestaltung des Erfahrungsaustauschs in den Regionen des Landwohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern
Die Veranstaltungen des LWV mit Sozialämtern, Jugendämtern und Beratungsstellen bieten einen strukturellen Rahmen für die Einbindung der Praxis in die Reflexion und Fortschreibung der Richtlinien. Die konzeptionelle Gestaltung der Veranstaltungen ermöglicht der Praxis, ihre Erfahrungen mit den Richtlinien zu artikulieren. Dies zeigt sich konkret daran, dass die Erfahrungen aus der Praxis mit in die Vorträge aufgenommen, die Vorträge kurz und selbstkritisch gehalten und viel Zeit zur Diskussion freigehalten wurde.
Die Folge war, dass die Veranstaltungen von den BesucherInnen sehr stark genutzt wurden, um Fragestellungen und kritische Erfahrungen sowie Verbesserungsmöglichkeiten einzubringen.
Aus der Fragerunde und Diskussion lassen sich in Bezug auf den Bereich Kindergarten folgende Erfahrungen festhalten, die sich bezüglich der Rolle der Assistentinnen, des Qualifizierungsbedarfs von Erzieherinnen und arbeitsrechtlichen Fragestellungen mit den Erfahrungen in Reutlingen decken:
4.2 Erfahrungen der TeilnehmerInnen
Strukturelle Vorgaben zur Gruppengröße
Gruppen, die Kinder mit Assistenzbedarf aufnehmen, sollten die Gruppengröße von 25 Kinder nicht überschreiten - so die Empfehlungen des Landeswohlfahrtsverbandes. Einige Anfragen lassen erkennen, dass Träger keine Grenzen setzen und auch in Gruppen mit 31 Kindern Eingliederungshilfe gewähren.
Die Richtlinien setzen und bauen auf ein hohes Maß an selbstverantwortliches Handeln von Trägern. Es ist daher nicht immer auszuschließen, dass Träger die Rahmenbedingungen nicht zur Verfügung stellen, um eine gute Integrationsarbeit zu ermöglichen. Die Empfehlungen zur Gruppengröße sind nicht rechtsverbindlich und können daher bisher nicht eingefordert werden.
Arbeitsrechtliche Fragestellungen
Integrative Hilfen und die damit verbundenen Vorstellungen von Integration von Kindern mit Assistenzbedarf sind für manche Träger nicht das zentrale Thema und Problem. Sie würden die Kinder gerne in ihre Gruppen aufnehmen, scheuen aber den Verwaltungsaufwand und die arbeitsrechtliche Vertragslage.
Wie können hierzu Arbeitsverträge, die ohne Risiko für den Arbeitgeber und doch mit Standards für die InklusionsassistentInnen ausgestattet sind, entwickelt werden?
Kindergartenträger
Aus den Fragen an die Träger wird deutlich, dass diesen eine sehr hohe Bedeutung zukommt, wie sie die integrativen Zuschüsse über Landesmittel und die Eingliederungshilfen in ihre Konzeptionen einbinden. Dabei stellt sich die Frage:
- Welchen Anteil übernehmen die Träger an integrativen Prozessen?
- Welche Reduzierungen nehmen Kindergartenträger konkret vor in Gruppen, die eine Betriebserlaubnis für Integrative Gruppen erhalten? Wird das Personal über 1.5 Stellen gefahren oder die Gruppe verkleinert?
Personeller Einsatz der AssistentIn und Besuchszeiten des Kindes
Einige Beispiele zeigen auch, dass Kinder mit Assistenzbedarf nur dann den Kindergarten besuchen können, wenn die Assistentin anwesend ist; konkret heißt dies, wenn eine Assistentin 10 Stunde pro Woche in der Gruppe ist, kann das Kind auch nur in diesem Zeitraum den Kindergarten besuchen. Das ist kein Einzelfall und wird nach Aussagen von Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen von Seiten der Träger damit begründet, dass ErzieherInnen Angst vor den Konsequenzen der Aufsichtspflicht haben und deshalb die Kinder nur kommen können, wenn die AssistentIn auch da ist.
Im großen und ganzen entsteht der Eindruck bei den Gesprächen, dass diese Form von Integrationsverständnis von der überwiegenden Zahl der TeilnehmerInnen nicht geteilt wird.
Wie können Träger überzeugt werden, dass ein Kind mit Assistenzbedarf das gleiche Recht zusteht und beschränkte Besuchszeiten integrative Prozesse hemmen?
Außerdem: Die Information über die Richtlinien sind bei den Trägern z.T. nicht bekannt oder werden unzulänglich ausgelegt. Infos, wie z.B. die Eingliederungshilfen werden auch während der Ferienzeit bezahlt oder können auch über ein Jahr hinaus bewilligt werden (Manche Sozialämter bewilligen nur 11 Monate und streichen den 12. Monat als Ferienmonat. -> Dies ist - so die VertreterInnen des LWV nicht Absicht und Wille des LWV.)
Definition und Förderung von Integrationsgruppen
Es besteht in den Gesprächsrunden Übereinstimmung, dass die bisherige ausschließliche Unterstützung des Halbstagskindergartens und Regelkindergartens keine umfassende Basis der Förderung bietet. Landkreise und Einrichtungen, die überwiegend verlängerte Öffnungszeiten anbieten, werden durch diese Regelung benachteiligt.
Was sind die Zieleinrichtungen der Eingliederungshilfe? In beiden Gesprächsgruppen besteht Übereinstimmung, dass die Eingliederungshilfe nicht nur für den Regelkindergarten gelten kann und eine Ausdehnung auf unter 3 Jährige in Horten etc. sinnvoll erachtet wird.
Die VertreterInnen des LWV sehen hier auch einen Veränderungsbedarf bei der Fortschreibung der Richtlinien: Die Öffnung für alle Formen der Betreuung soll angestrebt werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage: Welche nicht-stigmatisierende Formen der Förderung können entwickelt werden, um die Integration von Kindern, die von Ausgrenzung bedroht oder betroffen sind, zu ermöglichen?
Erzieherinnen
Der Bedarf an Weiterqualifizierung wird von einigen TeilnehmerInnen gefordert und deckt sich mit den Erfahrungen des LWV. Hier besteht ein großer Nachholbedarf.
AssistentInnen
Von Seiten der Beteiligten werden drei Dimensionen angesprochen, die mit einer qualitativen Assistenz verbunden sind: Erstens: Von Fachdiensten wird betont, dass die AssistentInnen eine Beratung und Begleitung benötigen, die aber mit Hilfe der Pauschalen der Eingliederungshilfen nicht finanziert werden können. Zweitens: Die IntegrationsassistentIn braucht besondere Kompetenzen, um den Kontakt zu dem Kind herzustellen, das Kind in die Gruppe zu integrieren und mit den Erzieherinnen und Eltern zusammenzuarbeiten. Drittens: TeilnehmerInnen begrüssen den Einsatz von unterschiedlichen päd./pfleg. Kräften. Die scharfe Trennung von Pädagogik und Pflege ist schwierig.
Verfahrensformen: Entscheidungsstrukturen und -prozesse
Die Gewährung von Eingliederungshilfen unterliegt unterschiedlichen Verfahrensformen. Während einige Träger und Beratungsstellen "Runde Tische" voraussetzen, sind sie anderswo eine Seltenheit.
Im Zuge von Transparenz, Partizipation und Kooperation bestätigen viele TeilnehmerInnen die positiven Auswirkungen von "Runden Tischen". Der zeitliche Aufwand lohnt sich, weil eine Klarheit über Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen in der Regel einen positiven Einfluß auf den Verlauf der Eingliederung mit sich bringt.
Beantragungszeit
Einige VertreterInnen monieren den langen Zeitraum bis zur Bewilligung von Eingliederungshilfen. Dabei sind die örtlichen Sozialämter die Stellen, an denen die Anträge liegen bleiben.
Frühförderstellen
Frühförderstellen sehen mit der Einführung der Richtlinien eine Mehrbelastung auf sich zukommen. Einzelne VertreterInnen von Frühförderstellen berichten, dass zuständige Schulämter bei Gewährung von Eingliederungshilfen versuchen, die FrühförderInnen aus der Arbeit herauszuziehen.
Die VertreterInnen des LWV betonen die Bedeutung der Frühförderstelle als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Beteiligten. In der Regel sind die MitarbeiterInnen der Frühförderstellen vor der Eingliederungsmaßnahme in den Familien und kennen die Kinder, so dass ihre Kompetenz dringend einbezogen werden muß und auch mit der Gewährung von Eingliederungshilfen keinen Abschluß finden kann.
Unklarheiten bestehen über die Gewährung verschiedener Hilfen. Die Gewährung von Eingliederungshilfe bedeutet nicht, dass dadurch automatisch die Frühforderung gestrichen wird. Die Leistungen bestehen unabhängig voneinander.
4.3 LWV-Politik - Integrativer Transfer in die Politik
Bei den Veranstaltungen wird von TeilnehmerInnen der Wunsch geäußert, dass der LWV die Förderung integrativer Maßnahmen in Kindergarten und Schule in den politischen Willensbildungsprozeß sowie bei der Neubestimmung des Kindergartengesetzes und bei der Fortschreibung der Eingliederungshilfen vehement vertreten solle.
- Kontrolle versus Vertrauen
- Grundsätze bei Gewährung von Hilfen, wie z. B. bei Integrativen Gruppen und Eingliederungshilfen. Für manche VertreterInnen - vor allem von seiten der bisherigen Entscheidungsträgern (Sozialamt) - sind die Möglichkeiten von zusätzlichen Mitteln (Integrative Gruppen, Eingliederungshilfen) zu wenig kontrolliert.
Zunächst ist positiv zu vermerken, dass die Kooperation und auch ein Vertrauen gegenüber den Trägern im Vordergrund des LWVs steht und keine bürokratischen Barrieren aufgebaut werden. Die integrativen Zielsetzungen des LWV´s stehen; sie schaffen Möglichkeitsräume und bringen die Diskussionen um Integration in Bewegung.
4.4 Fazit zu den Veranstaltungen
Aus den beiden Veranstaltungen sowie aus einer weiteren Tagung der GEW zur Integration im Kindergarten in Stuttgart zeichnen sich folgende wesentlichen Botschaften ab:
- Die Situationen vor Ort müssen gestaltet werden. Die Zusammenarbeit bedarf einer Regelung, die in Form z. B. "Runden Tischen" eine passgenaue und konsensfähige Gestaltung der Teilhabe entwickelt. Hier stellt sich die Frage, ob Runde Tische nicht generell eingerichtet werden, um Entscheidungsprozesse transparent zu gestalten und die Vernetzung der Zusammenarbeit zu installieren.
- Die Eingliederungshilfen müssen als ein Baustein begriffen werden, der die Möglichkeit von integrativen Kindergärten und Schulen unterstützt, aber als einzige Maßnahme inhaltlich und finanziell nicht ausreicht. Wie können die Strukturen vor Ort so entwickelt und vernetzt werden, dass Eingliederungshilfen optimal genutzt und als Teil eines Integrationssystems zum Tragen kommen?
- Die Qualifizierung von ErzieherInnen ist sowohl vom Bedarf als auch von der Notwendigkeit einer integrativen Ausrichtung der Kindergärten her zu gewährleisten. Die Entwicklung von Fortbildungsveranstaltungen zur Bewußtseinsentwicklung im Bereich integrativer Erziehung ist wünschenswert.
- Die Integration von Kindern mit Assistenzbedarf sollte nicht von Organisationsformen der Einrichtungen abhängig sein, sondern eine generelle Bezuschussung für integrationsfördernde Einrichtungen angestrebt werden.
- Aus den Gesprächen wird auch sichtbar, dass auch nach einem Jahr der Einführung der Richtlinien noch ein Informationsbedarf besteht und deshalb weitere Veranstaltungen zur Integration im Kindergarten und zur Umsetzung der Richtlinien notwendig sind.

